Andreas Schiesser: «Je häufiger eine Krankheit vorkommt, desto günstiger müsste das Medikament sein»
Bern/ , 11. Mai 2022
Andreas Schiesser kann nachvollziehen, dass Pharmafirmen hohe Gewinne anstreben. Was der Projektleiter Pharma und Medikamente bei curafutura nicht versteht: Weshalb die Politik nicht ihre eigene Agenda verfolgt zugunsten der Versicherten und Patienten.
Im Verband curafutura vereinen sich gemäss Slogan «die innovativen Krankenversicherer». Was heisst das für Sie?
Innovation bedeutet für mich, dass wir als Verband und gemeinsam mit unseren Mitgliedern Beiträge zur Optimierung des Gesundheitswesens leisten. Das Ziel: Die Ressourcen effizienter einzusetzen. Indem wir etwa darauf hinarbeiten, einen Weg aus der Preisspirale bei den Medikamenten zu finden.
Wie machen Sie das?
Es sind zum Beispiel politische Vorstösse, zu denen wir beitragen, um den gesetzlichen Rahmen zu verändern. Sie sind Beleg, dass curafutura fortschrittlich und aktiv nach Verbesserungen sucht.
Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, wie sich in einem stark regulierten Markt etwas verändern lässt?
Ein aktuelles Beispiel dafür sind die Bestrebungen zu Anreiz-neutralen Margen. Wir möchten, dass Ärzte und Apotheker, die Medikamente verschreiben oder abgeben, künftig mehr Generika oder Biosimilars verschreiben. Das kann nur passieren, wenn sie daran gleich viel verdienen, wie an den Originalpräparaten. Gemeinsam mit pharmaSuisse und FMH haben wir Vorschläge erarbeitet, um die falschen Anreize, die heute bestehen, auszuschalten.
Eine grosse Verbesserung?
Auf jeden Fall. Anreiz-neutrale Margen führen dazu, dass Arzneimittel kostengünstig und effizient eingesetzt werden. In Ländern, die dieses System bereits kennen, hat sich der Markt verändert, es besteht eine grössere Auswahl an Generika, was automatisch mehr Wettbewerb bedeutet.
Wo stehen wir betreffend der Medikamentenkosten in der Schweiz?
Im europäischen Vergleich haben wir die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben. In der Grundversicherung wurden letztes Jahr knapp 8 Milliarden Franken für Medikamente ausgegeben. Die Kosten im Bereich der Medikamente steigen in der OKP überdurchschnittlich. Vor zehn Jahren standen wir bei rund 5 Milliarden – das macht im Schnitt über 5 Prozent Kostenwachstum pro Jahr, 2021 waren es sogar 6,5 Prozent.
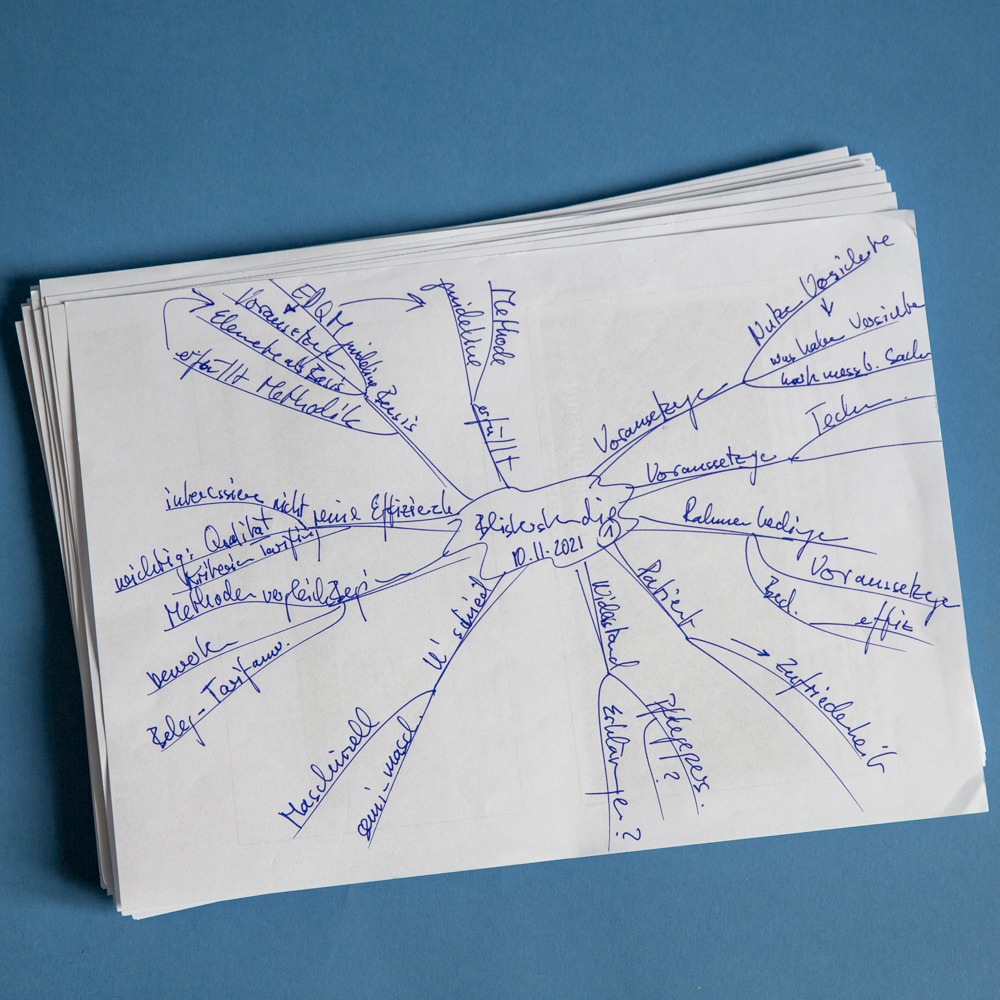
Wo müsste man ansetzen?
Die Frage lässt sich mit dem gewichteten Preis pro abgerechnete Einheit beantworten. Sei es eine Packung Medikamente, eine Applikation, eine Spritze: Der Preis dafür ist innerhalb von zehn Jahren von 41 Franken auf 64 Franken gestiegen. Das heisst: Wir haben einen Preiseffekt bei allen Medikamenten, die neu eingeführt werden. Wir befinden uns in einer Preisspirale.
Wie durchbricht man diese?
Ein Vorschlag von FDP-Ständerat und curafutura-Präsident Josef Dittli bietet einen interessanten Ansatz. Gemäss diesem sollen die Regeln zur Preisfestlegung um das Kriterium Prävalenz erweitert werden. Vereinfacht heisst das: Je häufiger eine Krankheit in der Bevölkerung vorkommt, desto günstiger sollte auch das Medikament zur Therapie dieser Krankheit sein. Das ist ein Kriterium, das im heutigen Regelwerk fehlt. Das macht auch wirtschaftlich Sinn. Bei höheren Volumen erreichen die Produzenten einen Skalen-Effekt. Davon sollten auch die Prämienzahler profitieren.
Wo sehen Sie weiteres Potenzial?
Indem man die bestehenden Regeln konsequenter anwendet. Gesetzlich sind Behörden und Versicherer verpflichtet, dass Leistungen kostengünstig erbracht werden. Das heisst: Sind zwei Leistungen vergleichbar, darf eigentlich nur die günstigere vergütete werden. Bei den Medikamenten ist dies aber anders: Das teurere Original muss ebenso vergütet werden wie das günstigere Generikum.
Weshalb werden diese Regeln nicht konsequent angewandt?
Es ist natürlich schwierig, wenn etwas im Gesetz festgehalten ist, die entsprechende Verordnung dazu aber im Widerspruch dazu steht. So müsste der therapeutische Quervergleich unabhängig vom Patentschutz mit der Standardtherapie durchgeführt werden. Das heisst: Eine neue Therapie muss bezüglich der Kosten mit der bisher eingesetzten Therapie verglichen werden können, egal ob diese patentgeschützt ist oder nicht. Nur so haben wir die Gewähr, dass ein therapeutischer Quervergleich auf gesetzlicher Ebene nicht eingeschränkt wird.
Warum unternehmen die Krankenversicherer nichts um diese Forderung durchzusetzen?
Rechtlich gibt es hier ein Ungleichgewicht: Die Pharmaindustrie kann gegen Entscheide des BAG rekurrieren, sonst jedoch keine Partei, die vom Entscheid betroffen ist, weder Krankenversicherer noch Patientenorganisationen. Hier müsste man gleich lange Spiesse schaffen. Die Pharmaindustrie dagegen beklagt sich, dass die Zulassung neuer Mittel sehr verzögert stattfindet. Der Grund dafür ist in den meisten Fällen die Diskussion um Wirtschaftlichkeit. Das heisst umgekehrt auch: Die Preise, die die Pharmaindustrie verlangt, sind zu hoch. Schauen wir dreissig, vierzig Jahre zurück, lässt sich eines konstatieren: Die absolute Höhe der Preise von Neueinführungen hat enorm zugenommen
Es ist klar, dass Pharmafirmen möglichst hohe Preise für ihre Medikamente anpeilen. Weshalb sollten günstigere Preise in ihrem Interesse liegen?
Einerseits könnte man sagen, moderate Preisforderungen begünstigten einen schnelleren Zugang zum Markt und zu den Patienten: Der Markt würde also schneller erschlossen. Da kann man eine gewisse Balance finden. Aber klar: Diese Unternehmen wollen Profite machen, die Investitionen, die sie tätigen, sind vor allem dort, wo grosse Gewinne zu erzielen sind. Seltene Krankheiten, Onkologie, Krankheiten mit hohem Preisniveau.
Die Schweiz ist ein wichtiger Standort dieser Industrie.
Ja sicher, wir bieten ja auch Standortvorteile. Schwierig wird es, wenn Prämienzahler mit ihren Prämien über die hohen Arzneimittelpreise Standortförderung betreiben müssen. Das geht nicht.

Welches sind die Preistreiber?
Preistreiber sind die onkologischen und immunologischen Medikamente und Arzneimittel für seltene Krankheiten. Generell beobachten wir eine immer breitere Auffächerung in immer seltenere Indikationen. Bei Blutverdünnern etwa gibt’s neue Medikamente mit Tagestherapiekosten von rund 2.60 Franken. Im krassen Gegensatz dazu stehen klassische Mittel, die 16 Rappen kosten. Das ist in vielen Fällen Marketing: Man sucht nach Differenzierung, damit man bei der Preisfestlegung argumentieren kann, dass die neuen Medikamente nicht mit den bewährten verglichen werden können.
Wenn Sie die verschiedenen Player durchgehen: Wer muss welche Rolle spielen, damit das System verbessert wird?
In erster Linie müssen die verschiedenen Player gut zusammenarbeiten. Wir glauben an die Partnerschaft und den gemeinsamen Willen, etwas zu verbessern. Darin spielt die Politik eine wichtige Rolle: Sie muss eine Ordnung schaffen, in dem sich das System tatsächlich bewegen kann und bewegt. Dann ist es am Bundesrat, das System in eine entsprechende Richtung zu leiten. In den letzten zehn Jahren hat er da im Bereich der Medikamentenpreise kaum etwas grundsätzliches gemacht.
Das sagen Sie!
… nein, das ist keine persönliche Einschätzung: Die Zielsetzungen «Gesundheit 2020» wurden klar verfehlt. Statt grundlegenden Reformen und Übernahme von Regelungen, die in anderen europäischen Ländern gut funktionieren, wird die bestehende Regulierung verfeinert und damit komplexer.
Und die Krankenversicherer?
Sie befinden sich am Ende der Kette und haben im Bereich Medikamente leider wenig operativen Einfluss. Das heisst, sie müssen die Kosten und die Regelungen übernehmen, die das Gesetz und die Verordnungen vorsehen. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung ist unser einziges konkretes Werkzeug. Deshalb konzentrieren sich unsere Bemühungen auf die Politik, dort wollen wir konstruktiv mitgestalten. Nur so können wir unsere Möglichkeiten erweitern, um die Interessen der Prämienzahler besser einzubringen.
